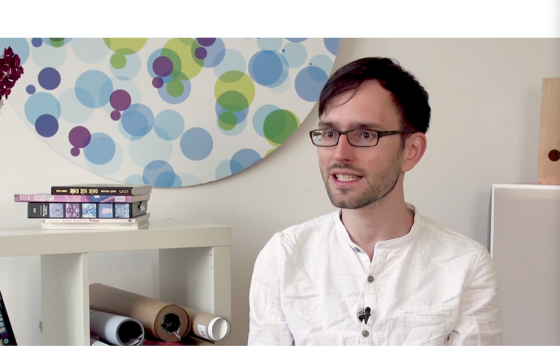Erinnerung, Sichtbarkeit und Emanzipation: Christopher Street Days

Woher kommt der Christopher Street Day?
Vielen Menschen in Deutschland sind die „Christopher Street Day (CSD)“ genannten Paraden mittlerweile ein Begriff. Die meisten großen Städte haben einen CSD, aber selbst in manch kleineren Orten, wie zum Beispiel Weimar oder Altötting, gibt es ähnliche Veranstaltungen. Der Name „CSD“ stammt von der Christopher Street in New York City. Als die Polizei 1969 zum wiederholten Male die Gäste in der Stonewall-Bar drangsalierte, begannen sich einige der Gäste und Passant*innen gegen die Polizei zu wehren. Mehrtägige Auseinandersetzungen mit der Polizei folgten.
Der sogenannte Stonewall-Aufstand war aber nicht das erste Mal, dass sich queere Menschen gegen Polizeiwillkür wehrten. Bereits in den Jahren davor gab es in anderen Orten der USA ähnliche Proteste. Beispiele hierfür sind der Compton's Cafeteria Riot 1966 und der Cooper Do-Nuts Riot 1959, die beide allerdings viel weniger Aufmerksamkeit in den Medien erhielten. Besonders häufig betroffen von der Polizeiwillkür waren Drag Queens und transgeschlechtliche Menschen, arme Menschen und Queers of Color, sodass diese oft die Aktivist*innen der ersten Stunde waren.
Auch in Deutschland waren die CSDs nicht die ersten öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten queerer Menschen. So gab es bereits 1972 in Münster die erste Schwulendemo. Viele Lesben waren hingegen in den 1970er-Jahren als Teil der feministischen Bewegung, zum Beispiel bei den sogenannten Walpurgisnachtdemos, sehr aktiv.
Zehn Jahre nach Stonewall, 1979, gab es dann die ersten CSDs in Deutschland. Zu Beginn wurden sie aber nicht immer so genannt. In Nordrhein-Westfalen hieß der entsprechende Aktionstag noch lange „Gay Freedom Day“. Die mittlerweile fast immer gleiche Bezeichnung setzte sich deutschlandweit erst im Laufe der Jahre durch. Außerhalb Deutschlands ist der Name „CSD“ wenig gebräuchlich.
Teilweise nahmen die Paraden und Aktionstage nur wenig konkreten Bezug auf die Ereignisse in der Christopher Street. Stattdessen wurde oft das Lokale betont. In Köln zum Beispiel gleicht der CSD eher dem bekannten Karneval.
In Frankfurt hingegen gab es die Demonstration unter dem Titel „Solidarität der Uneinsichtigen“. Hier wurde Bezug genommen auf Aussagen von Politiker*innen – so forderte der damalige CDU-Oberbürgermeister Frankfurts im Zuge der Aidskrise eine „lebenslange Quarantäne der Uneinsichtigen“, während in Bayern ein sehr restriktiver und viel kritisierter Maßnahmenkatalog verabschiedet wurde. Dieser Katalog thematisierte ebenfalls „Uneinsichtigkeit“ und sah zur Not auch eine „Absonderung“ Betroffener vor. Das Organisationsteam der Frankfurter Demonstration (und späteren CSDs) positionierte sich mit dem Titel „Solidarität der Uneinsichtigen“ klar gegen eine solche Haltung.
Die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft war zu Beginn der Paraden vor allem verdutzt über den Mut und die Forderung nach Sichtbarkeit der „Perversen“. Für viele war es schwer vorstellbar „so zu sein“, und das auch noch öffentlich zeigen.
Den Paraden wurde weitgehend friedlich begegnet, aber nicht alle waren über sie glücklich. Mitunter gab es auch offenen Widerstand. Vor allem Kirchen und Konservative waren kritisch gegenüber der eingeforderten Sichtbarkeit. Auch die Kommunalverwaltungen waren sich in der Anfangszeit oft nicht sicher, wie sie mit den Veranstaltungen umgehen sollten.
Mit dem gesellschaftlichen Wandel wurden die Paraden zunehmend akzeptierter. Die Verwaltungen wurden offener, die Veranstaltungen sichtbarer im Stadtbild zu platzieren und in der Vorbereitung zu unterstützen. Mittlerweile haben auch immer mehr Politiker*innen erkannt, dass die Unterstützung queerer Menschen zum positiven Image einer Stadt beitragen kann.
Gay Pride – worum geht es beim CSD?
In englischsprachigen Ländern wird oft von „Gay Pride“ gesprochen und CSD-Paraden heißen dort häufig so. Der Gedanke von Pride (dt.: Stolz) knüpft an andere soziale Bewegungen an. So wurde bereits in den 1960er-Jahren der Slogan „Black is Beautiful“ zu einem der Kampfschreie der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Angelehnt daran riefen auch schon beim Stonewall-Aufstand 1969 einige der Zuschauenden „Gay is good!“
Der Gedanke von Pride ist dabei nicht so sehr der Stolz auf etwas Zufälliges wie die sexuelle Orientierung. Vielmehr ist Pride ein Versuch des Widerstands gegen die Scham und das Stigma, das sexuelle und geschlechtliche Minderheiten bis heute immer wieder erleben.
Gleichzeitig ist Pride auch ein Feiern des eigenen Selbst und des Mutes, sich dazu zu bekennen, dass man nicht wie die meisten anderen ist. Comingout bedeutet heutzutage immer noch eine Überschreitung gesellschaftlicher Normen, die sich nicht jede Person traut, trauen kann oder überhaupt trauen will. Dementsprechend sind viele stolz, wenn sie den Mut und den Erfolg hatten, sich sichtbar zu machen.
Darüber hinaus ist Pride auch ein Stolz-Sein auf die bisher errungenen politischen Erfolge. Noch vor wenigen Jahren war queeres Leben oft kriminalisiert und unsichtbar. Die Courage und das Engagement vieler Aktivist*innen hat es erst ermöglicht, dass man heute CSDs feiern kann. Diese sind eine gute Gelegenheit, auf diese Fortschritte hinzuweisen und die jahrzehntelange politische Arbeit queerer Menschen zu feiern.
Warum gibt es innerhalb der Szene(n) Konflikte um die CSDs?
Auch in den queeren Communitys sind die CSDs Anlass für Auseinandersetzungen. Diese Auseinandersetzungen drehen sich oft um die Frage, wie offen politisch diese sein sollten – und welchen politischen Fragen man sich dann widmet. Außerdem wird oft bemängelt, dass der CSD kommerzialisiert sei, es also nur noch um Geld und Gewinn ginge. Hierdurch würden, so die Kritik, die eigentlichen politischen Ideen hinter der Parade verschwinden und der politische Gehalt unsichtbar gemacht werden.
Diese Auseinandersetzungen sind im Kern oft Debatten über Strategien und die Frage, wer eigentlich alles „zur Szene“ dazugehört und wessen Interessen Beachtung finden sollten. Ein Teil der Szene betrachtet hierbei eine Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft als hilfreich für eine größere Akzeptanz queeren Lebens. Man will zeigen, dass man ist wie jede*r andere auch.
Nach dem Zweiten Weltkrieg dachten viele politische Aktivist*innen so. Ein unauffälliges Anpassen an die Mehrheitsgesellschaft prägte den frühen Aktivismus – man machte Lobbyarbeit, betrieb Aufklärung und organisierte Szeneveranstaltungen, wollte aber nicht übermäßig auffallen. Erst etwa ab den 1970er-Jahren wandelte sich das. Die Bewegung in Deutschland knüpfte zunehmend an die sich in diesem Zeitraum entwickelnde schwul-lesbische Befreiungsbewegung in den USA, die Gay Liberation, an.
Im Zuge dessen gerieten zum einen das Thema einer speziell schwul-lesbischen Identität und deren Sichtbarkeit stärker in den Mittelpunkt. Zum anderen waren die Aktiven der Gay Liberation oft der Auffassung, dass die Emanzipation queerer Menschen nicht von anderen Arten der Diskriminierung und Unterdrückung losgelöst betrachtet werden könne: Auch Themen wie Rassismus, Sexismus und Transfeindlichkeit sollten thematisiert werden.
Mit den Erfolgen der letzten Jahre und Jahrzehnte, wie beispielsweise der „Ehe für alle“ und der zunehmenden Sichtbarkeit queeren Lebens, sind vermehrt Stimmen laut geworden, gemäß derer die Szene nun nicht mehr so radikal auftreten müsse. Statt die Differenz zur Mehrheitsgesellschaft zu betonen, wollen Teile der politisch Aktiven wieder stärker die Gemeinsamkeiten herausstellen und weniger den Zusammenhang mit anderen Unterdrückungsmechanismen thematisieren.
Heutzutage spielt sich der Konflikt zumeist zwischen den beiden Polen von Anpassung und Gay Liberation ab. Vertreter*innen der Strategie der Anpassung betonen, dass man bereits weit gekommen sei und statt radikaler Forderungen der Fokus eher auf breiter Massenwirkung liegen sollte. Unterstützer*innen des Gay-Liberation-Ansatzes hingegen sind der Meinung, dass auch heute noch sehr politische Forderungen notwendig seien und der Fokus auf jene Menschen gelegt werden sollte, die bisher nicht ausreichend Beachtung erhielten.
Kritisiert wird hier oftmals, dass die bisherigen Errungenschaften zwar sicherlich meist wichtig und richtig, aber nicht für alle Teile der queeren Bewegung gleichermaßen relevant seien: So begrüßen auch trans- und intergeschlechtliche Menschen die „Ehe für alle“; gleichzeitig sind für diese beiden Gruppen Fortschritte hinsichtlich der Wahrung ihres Rechts auf körperliche Unversehrtheit, der Anerkennung ihres Geschlechts und anderer Menschenrechtsfragen deutlich dringlicher. Auch für andere marginalisierte Gruppen ist die „Ehe für alle“ nur bedingt relevant, zum Beispiel wenn eine Hochzeit schon wegen der Kosten nicht in Frage kommt.
Sind die Themen auf den CSDs immer gleich?
CSDs sind als Teil sozialer Bewegungen auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung. Anhand der Mottos und erhobenen Forderungen der CSDs lässt sich erkennen, dass diese auch Kinder ihrer Zeit sind. So waren HIV/Aids und der Paragraph 175, der mann-männliche Homosexualität unter Strafe stellte, in den 1980er-Jahren und Anfang der 1990er-Jahre häufige Themen. In späteren Jahren gewannen dann Themen wie die „Ehe für alle“ an Bedeutung.
Gleichzeitig gibt es aber auch viele Kontinuitäten in den Themensetzungen. Ein Dauerthema ist dabei die fehlende Sichtbarkeit von Lesben. Um lesbische Sichtbarkeit zu stärken, gibt es an einigen Orten zum Beispiel die „Dyke Marches“, spezielle Lesbenmärsche. In Berlin findet dieser beispielsweise am Tag vor der eigentlichen CSD-Parade statt.
Mit zunehmendem Erfolg von queerem Aktivismus finden aber auch Präzisierungen und Weiterentwicklungen der Forderungen statt. Aus den anfänglichen Forderungen nach allgemeiner Sichtbarkeit wird nun die Forderung nach der Sichtbarmachung von denjenigen, die im öffentlichen Raum häufig am wenigsten gehört werden: trans* Personen und Queers of Color.
Gleichzeitig wird mitunter auch die Forderung nach stärkerer Reflexion innerhalb der eigenen Reihen laut. So stellt sich die Frage, welche sozialen Ungleichheiten zwischen queeren Menschen bestehen: Anja im Rollstuhl wird wahrscheinlich andere Erfahrungen machen als Ayşe, die vor Kurzem für das Studium nach Deutschland gezogen ist. Diese unterschiedlichen Erfahrungen sollen nicht mehr ignoriert werden.
Damit wird immer auch der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen: Die Gesellschaft wandelt sich und wird sich ihrer eigenen Vielfalt stärker bewusst. Damit können auch queere Communitys und ihre Themen nicht gleich bleiben. Politischen Debatten und die eigene Szene entwickeln sich weiter, das wird auch auf CSDs deutlich.
Autor: Heiner Schulze
Kurzbiografie: Heiner Schulze ist als Sozialwissenschaftler im Bildungs- und Kulturbereich tätig. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Nordhausen und lehrt in Berlin zum Thema soziale Ungleichheit. Darüber hinaus ist er im Vorstand des Schwulen Museums Berlin und ist dort in den Bereichen Veranstaltung und Bibliothek/Archiv aktiv. Seine Interessen- und Forschungsgebiete umfassen unter anderem soziale Ungleichheit und Marginalisierung, queere Geschichte und Geschichtsschreibung sowie kollektives Trauma, vor allem im Kontext von HIV/AIDS.